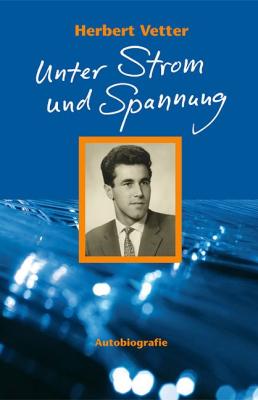Eine Biografie zu schreiben, bedeutet zuerst und vor allem, genau zuzuhören. Über Stunden, Tage. Das kann für mich wie für den Zeitzeugen sehr anstrengend sein. Der Erzähler meines aktuellen Biografieprojekts ist ein 91-jähriger Mann aus dem Badischen - nennen wir ihn Ernst. Im Alter von 18 Jahren war Ernst unsicher, ob er die kleine, elterliche Schlosserei übernehmen oder lieber als Techniker in einem Großbetrieb arbeiten wollte. Da kam ihm eine - wie er meinte - schlaue Idee. Warum sollte er nicht freiwillig für zwei Jahre zum Militär gehen. Irgendwann würde man ihn ohnehin einziehen, da wäre es besser, den Zeitpunkt selbst zu bestimmen. Also bewarb er sich und wurde genommen. Am 9. November 1938 - einem deutschen Schicksalstag - rückte er in die Kaserne ein. Wäre alles nach Plan verlaufen, hätte er im Herbst 1940 alles hinter sich gehabt. Es lief aber nichts mehr nach Plan in Ernsts Leben. Im Herbst 1940 saß er im besetzten Frankreich, 60 Kilometer südwestlich von Paris. Noch hatte der Krieg ihm keine großen Wunden zugefügt. Das aber sollte sich ändern. Im Frühjahr 1941 wurde seine Einheit nach Polen verlegt. Ernst erinnert sich noch gut an den Abend des 21. Juni 1941: »Wir wussten, dass etwas passieren würde, denn schon seit Tagen überschlugen sich die Gerüchte. Als unser Hauptmann den Befehl für den kommenden Tag verlas und mir klar wurde, dass wir in wenigen Stunden nach Russland einmarschieren würden, lief es mir eiskalt den Rücken herunter. Dieser Tag würde mein Leben verändern, das stand fest. Zum Glück hatte ich nicht die geringste Vorstellung, was mir wirklich bevorstand.«
Als Ernst mir vorgestern von seinen Erlebnissen der ersten Tage des Russlandfeldzuges erzählte - äußerlich ruhig, präzise, detailgenau - spürte ich seine ungeheure Erregung. Auch wenn fast 70 Jahre vergangen sind, das Trauma ist gegenwärtig. Er steuerte die Zugmaschine einer Panzerabwehrkanone. Drei Tage blieb alles ruhig. Sie marschierten nach Osten, ohne einem einzigen russischen Soldaten zu begegnen. Dann, am vierten Tag, wurden sie plötzlich und ohne jede Vorwarnung, wie aus dem Nichts beschossen. »Ich wusste zuerst überhaupt nicht, was los war. Plötzlich flog der linke Außenspiegel durch die Luft. Hatte ich irgendetwas touchiert und er war dadurch abgebrochen? Ich schaute nach rechts. Ottos Körper war seltsam verbogen, sein rechter Arm hing über die Tür nach draußen und seine Augen waren aufgerissen. Ich rüttelte an seinem Arm. Keine Reaktion. Ich schrie ihn an: »Mensch Otto, was ist los?« Nichts. Ich schaute mich um. Die Männer, die auf der Geschützlafette gesessen hatten, waren verschwunden. Bis auf einen Einzigen, aber auch der war nicht mehr richtig da. Sein Unterleib fehlte, die Gedärme schleiften über den Boden. Als ich wieder nach vorne blickte, sah ich die Männer des vor mir fahrenden Geschützes von der Lafette purzeln. Wie Marionetten, bei denen der Puppenspieler, die Fäden durchtrennte. Dann sah ich nichts mehr. Nur noch Rauch und Dreck. Ich spürte auch nichts mehr. Dachte nichts mehr. Warf mich auf den Boden des Fahrzeugs, hielt die Hände über dem Stahlhelm gekreuzt.«
Am Ende gelang es Ernst, sich zu retten. Sich und zwei seiner schwer verwundeten Kameraden, die er in sein Fahrzeug zog und aus der Schusslinie brachte. Dafür sollte Ernst das EK 1 bekommen. Er lehnte es ab. Er fühlte sich nicht als Held. Sollte sich nie so fühlen. In all den Jahren nicht. Er funktionierte, um zu überleben. Mehr nicht.
Er kam bis kurz vor Moskau. 1944 wurde er auf dem Rückzug in russische Gefangenschaft genommen. Die folgenden fünf Jahre verbrachte er in unterschiedlichen Lagern am Fuße des Ural nahe der Millionenstadt Perm. Schuftete. Fror und hungerte gemeinsam mit seinen Bewachern. Lernte russisch. Versuchte, dem Stumpfsinn zu entfliehen, Normalität im Irrsinn zu finden.
Im November 1949 durfte er zurück in seinen Heimatort. Fast auf den Tag genau 11 Jahre, nachdem er zum ersten Mal eine Militäruniform angezogen hatte. Er kam in ein Land, das ihm fremd war. Bundesrepublik Deutschland. Adenauer. D-Mark. Viele Freunde von früher waren tot oder verschollen. Wer überlebt hatte, schwieg. Niemand wollte mit ihm über seine verlorenen elf Jahre reden. Alle waren froh, dass es vorbei war, dass es endlich wieder aufwärtsging. Und so ließ auch Ernst die Vergangenheit ruhen, obwohl sie ihn nicht ruhen ließ, ihn nachts aus einem Alptraum aufschreckte. Er funktionierte. Gut sogar. Baute aus der kleinen Schlosserei seines Vaters ein Unternehmen mit mehr als 1500 Mitarbeitern auf. Machte es zum Weltmarktführer.
Drei Tage ließ Ernst im Gespräch mit mir, seinem Biografen, das Grauen wieder aufleben. Erzählte mir alle Einzelheiten, verschonte mich vor keiner Grausamkeit. Ich habe ihm zugehört, ihn getröstet und ermuntert. Nun trage ich den Schrecken mit mir herum. Der Horror wird mir auf der Seele liegen, bis ich die Geschichte aufgeschrieben habe. Damit Ernsts Enkel lesen können, was Krieg mit Menschen anrichtet. Ihr Opa kann es ihnen genau sagen.
broemmelhaus - 29. Jul, 10:21
Eine Frage, die mir häufig gestellt wird: Wie geht man als Biograf mit offensichtlichen Geschichtsklitterungen und persönlichen Verdrängungen um? Zunächst einmal muss man sie schlichtweg aushalten. Das klingt banal, ist es aber nicht. Die Arbeit an einer Biografie beginnt mit stundenlangen Gesprächen und Interviews, die sich über mehrere Tage hinziehen. Die Erzähler bzw. Erzählerinnen sind meistens schon in höherem Alter. Sie öffnen sich einem Fremden, der zudem noch um Jahrzehnte jünger ist, nicht binnen weniger Minuten. Vertrautheit will erarbeitet werden.
Signale von Empathie zu senden, zugewandt sein, aufmerksam und offen zuzuhören, Erzählfluss zuzulassen - das sind die Grundzutaten für ein gut geführtes biografisches Interview. Übrigens: Diese Fähigkeiten kann man nicht theoretisch erwerben, sondern nur in der Praxis. Deswegen ist Erfahrung das größte Kapital eines personal historian. Oft zeigt sich in diesen Gesprächen ein Dilemma. Ich muss eine große Nähe zum Erzähler herstellen, damit er sich mir so weit wie möglich öffnet. Gleichzeitig ermöglicht mir nur eine gewisse Distanz, gelassen mit historischen Ungereimtheiten umzugehen. Letztendlich hilft es, sich klarzumachen, dass jede Biografie eine völlig einseitige, individuelle Sicht auf die geschilderten Ereignisse liefert. Zudem hat jeder Erzähler einen eigenen Antrieb, eine besondere Motivation, sein Leben zu dokumentieren und seine Geschichte aufschreiben zu lassen. Das Spektrum reicht vom Selbstmarketing bis zur Lebensbeichte. Da gibt es den erfolgreichen Unternehmer, der aus dem Nichts eine Firma mit Weltgeltung aufgebaut hat. Oder die Gastwirtin, die trotz aller nach außen zur Schau gestellten Fröhlichkeit fast ihr ganzes Leben um ihren ersten Mann Adolf getrauert hat, mit dem sie vier Monate und dreizehn Tage verheiratet war, als ein Schrapnell seinen Kopf zerfetzte. Am 14. November 1941. In einem russischen Dorf rund 100 Kilometer östlich von Minsk. Und dabei war ihr Adolf doch nur Metzger und arbeitete als Koch in einer Feldküche.
So anders- und einzigartig diese Lebensgeschichten, so unterschiedlich die Herangehensweise an eine Biografie. Manchmal spielt die sogenannte »historische Wahrheit« überhaupt keine Rolle. In der Regel weise ich den Erzähler aber darauf hin, dass seine Darstellung sich nicht mit der allgemein akzeptierten Geschichtsschreibung deckt. Das bin ich meiner Ausbildung als Historiker schuldig. Oft ist der Erzähler dann überrascht, dass er sich geirrt haben könnte, und wir ändern diesen Textteil. Ich habe es aber auch schon erlebt, dass jemand starr an seiner Sicht der Dinge festhielt, weil genau das die Krücke war, die ihm einen Umgang mit vielleicht traumatischen Ereignissen überhaupt möglich machte. Ich solchen Fällen bleibt dem Biografen nichts anderes übrig, als zu schweigen.
broemmelhaus - 28. Jul, 10:19
Gerade habe ich mit der Arbeit an einer neuen Biografie begonnen, da kommt die vorherige Arbeit endgültig zum Abschluss. Auch wenn ich schon viele Jahre als Biograf arbeite und Dutzende Privatbiografien geschrieben habe, ist es immer wieder ein besonderer Moment, wenn das Paket aus der Druckerei eintrifft.

Im Grunde genommen weiß ich genau, was mich erwartet. Vom ersten Entwurf der Buchgestalterin als pdf bis zum Andruck auf Papier habe ich Umschlag und Innenleben etliche Mal in Augenschein genommen.
Aber es ist etwas völlig anderes, ein Buch in der Hand zu halten. Fadengeheftet. Mit Lesebändchen. Durchgehend vierfarbig gedruckt, damit auch die alten Schwarz-Weiß-Fotos ihre besondere Atmosphäre, ihre Patina behalten. Wenn es dann so besonders gut gelungen ist wie dieses Mal, dann fühle ich den Stolz jedes Kreativen, wenn er sein Werk in den Händen hält und es für gut befindet. Das ist es, wofür man arbeitet! Na gut, neben dem Honorar natürlich, denn nur von der Anerkennung allein kann man keine Brötchen kaufen. Ohne das gute Gefühl, etwas Bleibendes von Wert geschaffen zu haben, wäre es aber nur ein Brotjob. Und das wäre mir zu wenig.
broemmelhaus - 27. Jul, 14:12
Vor zwei Stunden habe ich ein Manuskript zur Buchgestalterin geschickt. Fast ein Jahr hat es von den ersten Interviews mit der Erzählerin gedauert, bis wir nun endlich die Produktion starten können - gerade noch rechtzeitig, damit das Buch zu ihrem 90. Geburtstag fertig wird.
Das Schreiben einer Auftragsbiografie ist ein eben ein Prozess. Dabei scheint am Anfang meistens alles klar und einfach. Ein Mensch möchte seine Lebensgeschichte aufgeschrieben und damit für nachfolgende Generationen bewahrt wissen. Oft sind des sogar die Kinder, die mehr aus dem Leben des Vaters oder der Mutter erfahren wollen. Also beauftragen sie einen Biografen - am liebsten natürlich mich.
Schon bei den ersten Interviews, also gleich zu Anfang der Arbeit, merke ich häufig, dass unter der Oberfläche ein ganzes Bündel weiterer Motive lauert. Der Erzähler möchte sich erklären, rechtfertigen, entschuldigen, anklagen, verteidigen, rächen - um nur einige der möglichen Beweggründe zu nennen. Manchmal fördern auch meine Recherchen Erkenntnisse zu Tage, die das eine oder andere Erlebnis in völlig neuem Licht erscheinen lassen. Darüber ist dann ausführlich zu reden und nicht selten erweisen sich auf den ersten Blick einfache Ereignisse im Spiegel ausführlicher Nachforschungen als sehr komplex.
Bei fast jedem Auftrag stößt der Biograf auf Erinnerungslücken des Erzählers, die mit Hilfe von Dokumenten, Fotografien oder anderen Zeitzeugenberichten geschlossen werden können. Auch das ein oft mühsamer, auf jeden Fall aber zeitraubender Prozess. Oft ist dieses prozessuale Erinnern den Erzählerinnen und Erzählern sogar wichtiger als das Ergebnis. Sie genießen die Gespräche mit ihrem persönlichen Biografen. Wann hört jemand in dieser Jugendwahngesellschaft einem alten Menschen stundenlang und aufmerksam zu?
So wichtig dieser Prozess auch ist, so sehr achte ich darauf, ihn irgendwann zu einem Ende zu bringen. Meine Aufgabe ist die schriftliche Dokumentation einer Lebensgeschichte. Der Prozess ist ein notwendiger Teil dieser Arbeit und nicht - wie etwa bei einem Therapeuten - das Ergebnis. Ich bin erst dann zufrieden, wenn der Erzähler seine Biografie als gedrucktes und gebundenes Buch in der Hand hält. Damit das noch zu seinen Lebzeiten gelingt, ist ein Stichtag, etwa ein unverrückbarer Geburtstagstermin, sehr hilfreich. Denn sonst könnte man ja noch ...
broemmelhaus - 20. Mai, 15:33
Hin und wieder google ich die Begriffe Autobiografie, Biografie, Biografie schreiben ..., um zu schauen, was die Kolleginnen und Kollegen so treiben. Heute stolperte ich über ein Angebot, das mich wirklich sprachlos macht. Da bietet ein Anbieter aus meiner alten Heimat eine Biografie im Umfang von 80 bis 100 Seiten zum Komplettpreis von 950 Euro an. Inklusive 25 Fotos. Inklusive drei Buchexemplaren im Format 20,5 cm x 20,5 cm, auf hochwertigem Papier gedruckt mit Hardcover-Einband und auch noch im Schuber.
Mein Honorar für eine Auftragsbiografie mit einem Umfang von 100 Seiten beträgt 7500 Euro. Macht also eine Differenz von 6.550 Euro. Da frage ich mich sofort: Wie kommen die Kollegen zu ihrem Preis?
Wie ich zu meinem komme, erkläre ich gerne. Vorweg: Von den 7.500 Euro, die ich meinem Kunden berechnet, muss zunächst die Mehrwertsteuer abgezogen werden – zum Glück beträgt sie bei einer Buchproduktion nur 7 %. Bleiben 7000 Euro. Gestaltung und Produktion von fünf Büchern, die in meinen Preisen stets enthalten sind, kosten rd. 800 Euro. Bleiben als Honorar für mich 6.200 Euro.
Für 100 Seiten Text führe ich als Grundlage rund 10 Stunden Interviews mit dem Auftraggeber. Für die Transkription der Interviews und das Schreiben einer ersten Manuskriptfassung benötige ich im Schnitt 70 Stunden. Ergänzende Interviews (4 Stunden) und Textüberarbeitung (25 Stunden) kommen hinzu. Zum Schluss bleibt noch die Produktionsüberwachung, Endkorrektur und Abnahme (12 Stunden). Summa summarum kommen 121 Arbeitsstunden zusammen. Mein Honorar pro Stunde beträgt – Taschenrechner raus - 51,24 Euro und liegt damit unter dem Stundenlohn eines KFZ-Mechanikers – vom Schlüsseldienst, den ich vor Monaten brauchte, als ich mich ausgesperrt hatte, gar nicht zu reden.
Gehe ich davon aus, dass der Kollege aus der schönen Universitätsstadt in Westfalen die gleiche Stundenzahl benötigt, ist ihm seine eigene Arbeitsstunde lediglich 7,85 Euro wert.
Die ganze Rechnerei hätte ich mir sparen können, wenn ich mir gleich die auf der Website veröffentlichten Referenztexte angesehen hätte. Die Kollegen drucken in ihren Büchern augenscheinlich die weitgehend unbearbeiteten Interviewtranskripte ab – ohne nennenswerte Überarbeitung und zudem noch voller orthografischer Fehler. In dem Fall kann man also sagen: So ein Text ist auch nicht mehr wert als 950 Euro.
Am liebsten würde ich einfach einen Link auf die entsprechende Seite dieses Biografiedienstes setzen. Aber ich lasse es lieber. Nicht, um die Kollegen zu schützen, sondern weil es zu peinlich für unsere ganze Branche wäre.
broemmelhaus - 7. Nov, 15:58
- 0 Trackbacks
Heute kann ich nicht anders. Heute muss ich autobiografisch werden.
Es geht mir wie jedem Menschen: An einige Tage der persönlich erlebten Weltgeschichte kann ich mich sehr genau erinnern. Kein anderer Tag aber ist mir so genau im Gedächtnis, wie der 20 Juli 1969, genauer die Nacht vom 20. auf den 21. Juli. Ich war dreizehn Jahre alt und im Gegensatz zu heutigen Dreizehnjährigen interessierte ich mich nur für eins: Raumfahrt. Als mit Gemini 3 das Mondlandeprogramm der Amerikaner begann, war ich knapp acht Jahre alt und trotzdem kenne ich noch heute die Namen der beiden ersten Astronauten (Virgil Grissom und John Young). Der Virus hatte mich gepackt und er bekam reichlich Nahrung. Im Abstand von nur wenigen Monaten starteten Geminiraumschiffe zu immer längeren und technisch anspruchsvolleren Missionen. Ich lernte in dieser Zeit lesen und verschlang alles, war mir über Raumfahrt in die Hände fiel. Die Flüge ins All lieferten großartige Bilder und große Emotionen.
Ich weinte vor Trauer, als während eines Bodentests am 27. Januar 1967 Virgil Grissom, Edward H. White und Roger B. Chaffee in der Apollokapsel verbrannten. Ich weinte vor Rührung und Freude als Kommandant Frank Borman Weihnachten 1968 seine Weihnachtsbotschaft aus der Mondumlaufbahn vorlas.
Und jetzt also Apollo 11. Die ganze Familie hatte vier Tage zuvor nachmittags gegen halb drei vor dem Fernseher gesessen, als die Saturnrakete abhob. Fernsehen durften wir selten – Radiohören schon. Also lief ich nur noch mit dem Transistorradio in der Hand durch die Gegend, um ja kein Detail des Fluges zu verpassen. Wobei: niemand sprach von Flug. Mission war das viel treffendere Wort.
Diese Mission lief perfekt und heute war der Tag, auf den ich seit Jahren hinfieberte. Dabei begann er zäh wie Gummi. Ein typischer Sonntag meiner Kindheit eben. Dem morgendlichen Kirchgang mit den Eltern folgte das Warten auf das Sonntagsbratenmittagessen. Danach Mittagsruhe und anschließend Kaffee und Kirschkuchen auf der Terrasse.
Ich war aufgeregt, wie nie zuvor. Die entscheidende Frage war noch nicht geklärt: Würde ich die Fernsehübertragung in der Nacht sehen dürfen? Ich bettelte seit Tagen darum, doch noch hatte Vater seine Erlaubnis nicht erteilt. Jetzt endlich, den Mund noch voller Kirschkuchenstreusel, konnte ich aufatmen. Vater würde mich um drei Uhr am Morgen wecken. Tatsächlich schlief ich keine Stunde in dieser Nacht. Was, wenn der Vater einschlief oder mich einfach vergaß? Das Risiko konnte ich nicht eingehen. Schon um zwölf stand ich im Schlafanzug im Wohnzimmer.
„Was willst du den schon hier?“
„Ich kann nicht schlafen.“
Die Mutter katte Verständnis.
„Karl, lass ihn doch!.“
Also durfte ich mich anziehen und setzte mich zu den anderen, die schon vor dem Fernseher versammelt waren.
Selbst dem ansonsten stoisch ruhigen Chefkommentator Günther Siefahrt war die Aufregung anzumerken. Dabei passierte die nächsten Stunden nichts. Es wurde viel unverständliches Zeug geredet und im Hintergrund sah man das immer gleiche Bild des Kontrollzentrums in Houston.
Endlich, kurz vor vier, begann die Liveübertragung vom Mond. Zu erkennen war kaum etwas und trotzdem waren es die großartigsten Bilder, die ich je gesehen hatte. Ich bekam einen Kloß im Hals und die Tränen liefen mir übers Gesicht. Was für ein Augenblick! Ich zum ersten Mal dabei, als ein neues Kapitel der Menschheitsgeschichte begann.
Nur die fast achtzigjährige Oma störte, weil sie ständig wiederholte:
„Das kann doch nicht sein, der Mond ist doch viel zu klein. Da kann man doch nicht drauf rumlaufen.“
Heute Abend, genau vierzig Jahre später, werde ich wieder vor dem Fernseher sitzen. Ich werde wieder einen Kloß im Hals haben, wenn ich die verschwommenen Bilder sehe und Siefahrt sagt:
„Da, das Bein! Amstrongs Bein. Jetzt sieht man es deutlich.“
Vielleicht kann ich heute Abend die Tränen zurückhalten.
Oma wird diesmal auch nicht stören.
Schade, eigentlich.
broemmelhaus - 20. Jul, 15:54
Es ist für mich jedes Mal wieder etwas ganz Besonderes, den eigenen Text von professionellen Schauspielern gesprochen zu hören. Wie wahrscheinlich jeder Autor lese ich meine Texte vor der Publikation mehrfach laut. Oft fallen mir erst dabei Bandwurmsätze oder fehlende Rhythmik auf. Von Profis gelesen wird das eigene Werk aber quasi geadelt, denn sie umgehen alle vorhandenen Schwachstellen mit ihrer Kunst.
Viele von Ihnen wissen wahrscheinlich nicht, dass es eine Blindenbücherei gibt, bei der blinde und schwer sehbehinderte Menschen Hörbücher aller Genres kostenfrei ausleihen können. Rund 12.000 Buchtitel sind derzeit verfügbar, täglich werden zwischen 800 und 1200 Versandboxen ausgeliefert und angenommen - das ergibt eine jährliche Ausleihe von 250.000 Boxen.
Zum Bestand dieser Blindenbücherei gehört nun auch das gemeinsam mit der blinden Autorin Ruth Wunsch geschriebene Reisebuch „Wie fühlt sich Australien an?“
Im Internetkatalog der Blindenbücherei heißt es dazu:
Wie fühlt sich Australien an?
Ruth Wunsch und Matthias Brömmelhaus reisen wieder - diesmal vier Wochen lang kreuz und quer durch Australien. Dabei werden die beeindruckenden Landschaften von der Wüste des Outback bis zu den Tropen Queenslands, die faszinierenden Metropolen und die weltberühmten Kultur- und Naturdenkmäler jeweils aus der Sicht eines Sehenden und einer Blinden beschrieben. Verlag: Konstanz: Biograph. Bibliothek, 2008, gelesen von: Ruth Rockenschaub, Kurt Glockzin, 330 Minuten
Buchnummer 210269
Weitere Informationen zur Norddeutschen Blindenhörbücherei e. V. und zur Stiftung Centralbibliothek für Blinde finden Sie
hier.
broemmelhaus - 19. Jun, 16:13
Im Rahmen der „Tour de Braille“, einem Lesemarathon, mit dem bundesweit an den Erfinder der Blindenschrift erinnert wird, hatte ich das Vergnügen, gemeinsam mit Ruth Wunsch aus unseren Reiseberichten zu lesen.

Ein ungewöhnlicher Abend, nicht nur, weil meine blinde Co-Autorin ihre Texte mit den Fingern las, sondern auch wegen des besonderen Ortes, denn die Veranstaltung fand auf der Flussschifferkirche in Hamburg statt.
broemmelhaus - 16. Jun, 15:34
Ruth Wunsch, mit der und für die ich seit einigen Jahren Bücher realisiere, ist Gewinnerin des Schreibwettbewerbs "Mein Brief an die Gesellschaft von morgen". Aktion Mensch und Diakonisches Werk würdigen damit den "Brief an die Zukunft" der 78jährigen Hamburgerin. Auf der Homepage zum Wettbewerb heißt es:
"Sie empfindet es schon als leichte Kränkung, wenn sie als "ältere Dame" angesprochen wird. Denn Ruth Wunsch fällt es schwer, das Älterwerden zu akzeptieren, weil Senioren gern "aufs Abstellgleis" geschoben werden. Dagegen entwickelt sie überzeugende Strategien und erklärt, was es mit der "Arx AG" auf sich hat."
Den Brief an die Zukunft von Ruth Wunsch finden Sie
hier.
Wie schon einige andere Autoren zuvor, macht auch mein "jüngster" Erzähler seine Autobiografie den Gästen seiner Geburtstagsfeier zum Geschenk.
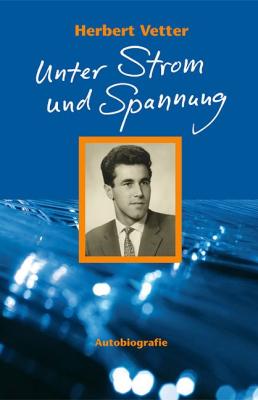
In diesem Buch schildert er seinen Weg als mittelständischer Unternehmer, dem der Erfolg nicht in die Wiege gelegt wurde. Mit eisernem Willen, Fleiss und Disziplin arbeitete er an seiner persönlichen Entwicklung und führte sein Unternehmen zur Marktführerschaft.
Wer jemals einen umfangreicheren Text geschrieben hat, kennt das Problem: Alle bekannten Textverarbeitungssysteme eignen sich nur bedingt für Texte von mehr als 20 oder 30 Seiten. Vor allem die Überarbeitung der Texte einschließlich der Rechtschreibkorrektur ist ein mühsames Geschäft, egal ob man Microsoft Word oder OpenOffice benutzt. Durch Zufall stieß ich vor einigen Wochen auf ein Officesystem, das von sich behauptet, speziell für Schriftsteller und Vielschreiber konzipiert zu sein:
Papyrus Autor.
Anfangs war ich sehr skeptisch. Andererseits hatte der von mir sehr geschätzte
Andreas Eschbach an der Entwicklung von Papyrus Autor mitgearbeitet. Da musste was dran sein.
Nachdem ich Papyrus Autor nun ein paar Wochen nutze, weiß ich nicht mehr, wie ich vorher ohne diese Software ausgekommen bin. Viele der Funktionen von Papyrus Autor sind perfekte Hilfsmittel. Ich nutze besonders intensiv die Notizzettel und Textschnipselfunktion. Damit lassen sich Ideen, die einem während des Schreibprozesses zu einer bestimmten Szene kommen, sofort auf einem „Klemmbrett“ neben dem Text festhalten. So stehen sie bei jeder Überarbeitung unmittelbar zur Verfügung. Genauso einfach kann man Passagen, die einem an einer Stelle nicht mehr gefallen, auf das Klemmbrett ziehen und sie später an einer anderen Stelle per drag & drop wieder einfügen. Die Größe dieser Textblöcke spielt dabei keine Rolle, man kann auf dem Klemmbrett auch ein ganzes Kapitel „zwischenlagern“.
Sehr funktionell ist auch die Kapitelübersicht, in der man den Bearbeitungsstatus jeder einzelnen Szene dokumentieren kann.
Am beeindruckendsten ist aber sicher die Stilanalyse, die auf dem „10-Punkte-TÜV“ zur Textüberarbeitung von Andreas Eschbach beruht. Sie hilft jedem professionellen Autor oder ambitionierten Hobbyschreiber, die eigenen Schreibschwächen aufzufinden. Wortdopplungen, Füllwörter, zu lange Sätze, Aufblähungen und andere Unwörter – alles wird von der Stilanalyse markiert. Dazu kommt ein Thesaurus, der sofort Alternativen liefert und von einem Selbst ergänzt werden kann.
Integriert ist außerdem der DudenKorrektor in der neuesten Version. Im Gegensatz zum bisher von mir genutzten OpenOffice Writer arbeitet der Korrektor hier so schnell, dass man ihn während des Schreibens mitlaufen lassen kann, ohne dass die Performance der Software bei langen Dokumenten verlangsamt wird.
Dazu kommen viele „kleine“ Dinge wie z. B. die intelligente Leerzeichenkontrolle beim Einfügen der Texte.
Ich bereue auf jeden Fall keinen Cent der 149,-- Euro, die Papyrus Autor kostet.
broemmelhaus - 21. Apr, 15:04
„Meine“ Biografien entstehen in der Regel auf der Basis ausführlicher Gespräche mit den Erzählerinnen und Erzählern. Diese mehrtägigen Interviews bergen oftmals Überraschungen. So auch diesmal, als ich meine Auftraggeberin und Erzählerin in ihrem Haus in Dachau besuchte. „Damals bei uns in China“ hieß es oft, wenn sie sich an ihre Schulzeit in der Kaiser-Wilhelm-Schule in Shanghai erinnerte. Von 1927 bis 1934 lebte sie mit ihren Eltern in China und erzählte anschaulich vom noch sehr kolonial geprägten Alltagsleben.
Was für eine interessante Parallele zur Medienöffentlichkeit der letzten Wochen, in der ausführlich über John Rabe, den „guten Deutschen von Nanking“ berichtet wurde. Noch habe ich den gleichnamigen
Film nicht gesehen, aber das hole ich jetzt nach. Ganz sicher!
broemmelhaus - 20. Apr, 11:08